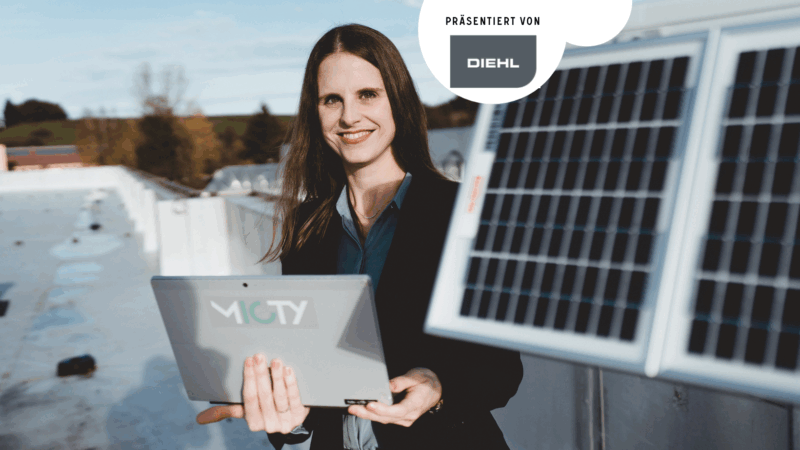Emotionale Arbeit: Die unsichtbare Leistung von Frauen für resiliente Teams

Im Job und im Privatleben schultern Frauen häufig kontinuierlich mehr emotionale Arbeit als Männer. Das gilt auch dann, wenn der Druck besonders hoch ist. Eine Untersuchung der Harvard Business Review zeigt eindrücklich: Während Frauen an besonders stressigen Tagen auch in ihrem privaten Umfeld emotional präsent bleiben, also zuhören, Trost spenden und Zuneigung zeigen, ziehen sich Männer deutlich stärker zurück. Das Ergebnis: Familiäre Verbindungen leiden, die Qualität gemeinsamer Zeit nimmt messbar ab.
Ein ergänzender Blick ins Arbeitsleben eröffnet überraschende Parallelen. Erleiden Männer im privaten Bereich Stress, sinkt auch ihre Bereitschaft, im Team emotionale Unterstützung zu leisten. Das hat spürbare negative Auswirkungen auf Team-Bindung und die Dynamik. Frauen hingegen bleiben konstant empathisch und unterstützend, selbst wenn das Privatleben herausfordernd ist. Den gegenseitigen Einfluss von Beruf und Privatleben bezeichnet man als Spillover-Effekt. Er ist einer von vielen Hinweisen darauf, dass sich die beiden Bereiche nicht vollständig voneinander treffen lassen, weshalb Vereinbarkeit ein zunehmend wichtiger Faktor in der Arbeitswelt ist.
Die Bedeutung von emotionaler Arbeit als wichtige Ressource wird oft unterschätzt
Emotionale Unterstützung im Team erscheint auf den ersten Blick vielleicht als nettes Extra. Doch Studien zeigen, dass sie handfeste Vorteile bringt. Laut der Untersuchung „Social Support and Its Impact on Job Satisfaction and Emotional Exhaustion“ fördert sie Team-Zufriedenheit messbar und senkt gleichzeitig mentale Erschöpfung. Emotionale Bindung wirkt sich positiv auf Leistung aus. Das belegen mehrere Meta-Analysen. Frauen tragen hier einen oft unterschätzten, aber entscheidenden Qualitätsbaustein zum Teamerfolg bei.
Anstatt emotionale Arbeit als „Soft Skill“ abzutun, sollten Unternehmen sie als strategische Ressource wertschätzen. Das bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die empathische Kompetenzen bei allen stärken – nicht nur bei Frauen. Inklusive Prozesse, psychologische Sicherheit und empathieorientierte Führung können emotionale Arbeit sichtbar machen und fair verteilen.
Geschlechterunterschiede bei emotionaler Unterstützung: Woher kommen sie?
Teilweise lassen sich die Differenzen auf soziale Rollenerwartungen zurückführen. Frauen fühlen sich aufgrund ihrer Sozialisierung häufig stärker zur Fürsorge verpflichtet. Auch nehmen sie im Arbeitskontext oft an, dass ihre Position im Team von emotionaler Fürsorge abhängt. Auch gibt es einen positiven Effekt: Mentale Arbeit für andere kann gleichzeitig die Stressbewältigung fördern und das eigene Wohlbefinden steigern. Männer hingegen tendieren dazu, ihre Rolle im Job als selbstverständlich anzusehen. Emotionale Unterstützung wird deshalb seltener als zentrale Aufgabe wahrgenommen, besonders unter privatem Stress.
Die Lösung liegt auf der Hand. Wenn Rollenklischees reflektiert werden und Männer aktiv in emotionale Care-Aufgaben eingebunden werden, können auch sie die positiven Effekte von Unterstützung – wie ein stärkeres Wohlbefinden, bessere Zusammenarbeit und höhere Zufriedenheit – erleben. Eine faire Verteilung von Mental Load, sowohl zu Hause als auch im Team, stärkt nicht nur die Leistung, sondern auch die Resilienz.